Dr. Olaf-Axel Burow (IF – Institute for Future Design, Deutschland)
# Schule der Zukunft: Sieben Handlungsoptionen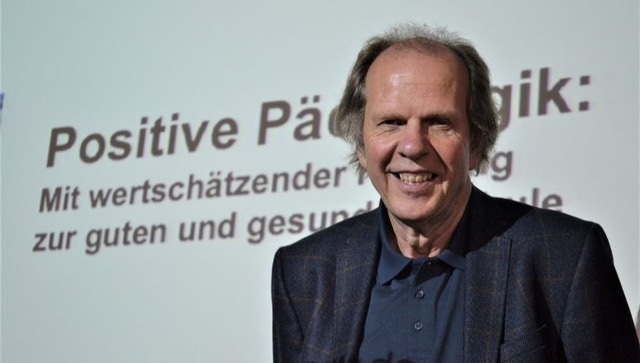
Unser traditionelles Modell des Erziehens und des Schulveranstaltens ist an seine Grenzen gekommen und bereitet Heranwachsende nur unzureichend für das Leben in einer Welt wachsender Herausforderungen vor. Um die junge Generation wirkungsvoll darin zu unterstützen, mit Unsicherheit und Komplexität proaktiv umzugehen, und sie zu befähigen, in ihrem Bereich Zukunft aktiv zu gestalten, benötigen wir Schulen, die zu faszinierenden Orten begeisternden Lehrens, Lernens, Forschens und Begegnens werden. Nicht „Rückkehr zur Normalität“ ist nach Corona gefragt, sondern eine Neuerfindung von Schule, die Heranswachsende schon von der Grundschule an befähigt, einen Beitrag zur Gestaltung einer zukunftsfähigen Welt zu leisten. Welche Konsequenzen dies für eine veränderte Schul-und Unterrichtsgestaltung bzw. die Schaffung lernförderlicher Umgebungen hat zeige ich in meinem einführenden Vortrag, der eine Grundlage für den anschließenden Austausch über gemeinsame Entwicklungsideen und Umsetzungsprojekte ist.
Prof. Dr. Olaf-Axel Burow
lehrte bis 2017 Allgemeine Pädagogik an der Universität Kassel, ist seitdem Direktor des IF Institute for Future Design, Autor zahlreicher Fachbücher zu Pädagogik Organisationsentwicklung und Kreativitätsforschung (zuletzt „Durch KI zu leidenschaftlicher Bildung – ein Manifest“ 2024; „#Schule der Zukunft. Sieben Handlungsoptionen“ 2022; „Positive Pädagogik – Sieben Wege zu Lernfreude und Schulglück“ 2021). Er ist Mitherausgeber der Zeitschriften „Pädagogische Führung“ sowie „Grundschule“ und berät Bildungseinrichtungen im In- und Ausland, aber auch DAX-Unternehmen in Change-Prozessen (www.olaf-axel-burow.de www.if-future-design.de).
Dr.in Hildegard Kurt (und.Institut für Kunst, Kultur und Zukunftsfähigkeit e.V., Berlin, Deutschland)
Erkundung am Epochenrand
Als Menschheit befinden wir uns in einer historisch beispiellosen Lage: Die bio-physischen Belastungsgrenzen des Planeten sind erreicht. Der Wissenschaft zufolge stehen praktisch alle lebenserhaltenden Systeme – namentlich Klima, Artenvielfalt, fruchtbarer Boden – vor Kipppunkten mit unabsehbaren Folgen. Wie können wir uns derlei zuwenden, ohne in Resignation, Zynismus, Zukunftsangst zu geraten? Wo gibt es Ermutigendes, Inspirierendes, das Kraft für konstruktives Handeln spendet? Was kann Bildung hierzu beitragen? Aus kulturphilosophischen, wissenschaftlichen und gesellschaftspolitischen Perspektiven beleuchtet diese Erkundung einen Weltbezug, der nicht mehr auf Nutzen und Kontrolle aus ist, sondern auf das Kultivieren von Lebendigkeit. Der Vortrag generiert »Richtkräfte« (Joseph Beuys), um vom Feld der Bildung aus das, was ist und was kommen wird, zu bewältigen – als offene Gesellschaft.
Drin Hildegard Kurt
ist Kulturwissenschaftlerin, Autorin und praktisch auf dem Feld des Erweiterten Kunstbegriffs (Beuys) tätig. Mitbegründerin des und.Institut für Kunst, Kultur und Zukunftsfähigkeit e.V. (und.Institut) mit Sitz in Berlin. Bis 2013 Lehrtätigkeit am Social Sculpture Research Unit der Oxford Brookes University, GB, zuletzt als Senior Lecturer. Zu ihren Publikationen zählen »Die rote Blume. Ästhetische Praxis in Zeiten des Wandels« (2013, mit Shelley Sacks), »Lebendigkeit sei! Für eine Politik des Lebens. Ein Manifest für das Anthropozän« (2015, mit Andreas Weber) und »Die neue Muse. Versuch über die Zukunftsfähigkeit« (2017). Vielfältige Vortrags- und Seminartätigkeit sowie Mitwirkung in Gremien und Beiräten.
Dr.in Katharina Kalcsics (PH Bern, Schweiz)
„Fachdidaktiken – Was sonst.“
Fachdidaktisches Wissen und Können wird in Modellen zur Professionskompetenz von Lehrpersonen (Baumert & Kunter, 2006) als eigenständiger Wissensbereich definiert und lässt sich auch empirisch von fachlichem und pädagogischem Wissen abgrenzen. Pauli & Reusser (2021) sprechen sogar von einer „fachdidaktischen Wende“ in der Lehr-Lernforschung. Was bedeutet dies nun konkret für die Fachdidaktiken als wissenschaftliche Disziplinen in der Lehrer:innenbildung? Welche Aufgaben haben die Fachdidaktiken an der Schnittstelle von disziplinärem Wissen, Vorstellungen der Schüler:innen und gesellschaftlichen Ansprüchen an die Grundschule? Im Vortrag werden diese Fragen diskutiert und ein Ausblick gewagt, wie auf der Grundlage des aktualisierten Shulman-Modells zur Professionskompetenz von Lehrer:innen der Aufbau einer multiplen fachdidaktischen Wissensbasis im Studium angegangen und die interdisziplinäre Zusammenarbeit bei der Entwicklung einer professionellen Handlungspraxis theoretisch fundiert werden kann.
Katharina Kalcsics, Prof. Dr. phil., PHBern, Institut Primarstufe
Bereichsleiterin Fachwissenschaften und Fachdidaktiken am Institut Primarstufe der PHBern und stellvertretende Institutsleiterin. Co-Leiterin des Masterstudiengangs Fachdidaktik Natur, Mensch, Gesellschaft und Nachhaltige Entwicklung der PHBern & PH Luzern; Doktorat in Geschichte/Zeitgeschichte, Karl-Franzens-Universität Graz.
Arbeitsschwerpunkte: Fachdidaktische Grundlagen in Natur Mensch Gesellschaft (Sachunterricht) + Nachhaltige Entwicklung; historisches und politisches Lernen in der Primarstufe; fachdidaktische Unterrichtsentwicklung & Unterrichtsqualität.
Michael Bruneforth, MA (Institut des Bundes für Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen [IQS], Salzburg, Österreich)
„Datenvielfalt in der Schule von heute als komplementäre Quelle informierten Handelns für morgen“
Österreich blickt wie viele andere Länder auf ein Vierteljahrhundert von Initiativen zur schulischen Qualitätsentwicklung zurück und auf eine ebenso lange Tradition, Datennutzung durch Schulleitungen und Lehrer/innen zu fördern. Parallel dazu hat sich nicht nur die Vielfalt des Datenangebots für Schul- und Unterrichtsentwicklung weiterentwickelt, sondern auch die Sicht der Wissenschaft darauf, wie erfolgreich mit Daten gearbeitet werden kann. In Österreich wurde ab 2017 das Qualitätsmanagement an Schulen neu aufgestellt (Bildungsreformgesetz 2017) und das System nationaler Kompetenzmessungen reformiert (Pädagogikpaket 2018). Der Vortrag möchte diskutieren, wie die Idee der Datennutzung sich von mechanistischen Modellen weiterentwickeln sollte, um den Bedürfnissen schulischer Akteurinnen und Akteure besser gerecht zu werden und wie der wahrgenommene Konflikt zwischen Daten für Entwicklung und für Rechenschaft entschärft werden kann. Im Rahmen des Vortrags werden die Überlegungen zur Datennutzung anhand des österreichischen QMS und der iKMPLUS illustriert.
Michael Bruneforth, MA, Institut des Bundes für Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen (IQS)
Wissenschaftler im Referat Forschungs- und Projektservices am IQS. Mitarbeit am Nationalen Bildungsbericht 2021 und Mitherausgeber früherer Ausgaben. Mitarbeit an der Konzeption der neuen iKMPLUS. Arbeitsschwerpunkte: Kompetenzmessungen, Bildungsindikatoren, Bildungsungleichheit. Vor 2011 arbeitete Michael Bruneforth beim UNESCO Institute for Statistics in Montreal, bei der OECD in Paris und der International Association for the Evaluation of Educational Achievement in Hamburg an internationalen Bildungsstudien und Bildungsmonitoring. Michael Bruneforth hat einen Master of Evaluation and Assessment der University of Melbourne.
